|
|
Verleih:
Seit einiger Zeit arbeiten wir daran, ein eigenes Filmarchiv
aufzubauen. Kopien daraus können bei uns ausgeliehen werden. Nur
in seltenen Fällen besitzen wir die Aufführungsrechte der Filme.
Diese müssen beim Rechteinhaber eingeholt werden. Dabei sind wir
gern behilflich.
Filmpatenschaften:
....>>>
Verleihbedingungen für Filmkopien, bei denen wir nicht im Besitz
der Aufführungsrechte sind:
Kopiennutzung: 160,- Euro
Hin- und Rücktransport per Kurierdienst zu Lasten des Kinos
Werbematerial 10,- Euro
Verleihbedingungen für Filmkopien, bei denen wir im Besitz der
Aufführungsrechte sind:
Mindestgarantie: 160,- Euro
Prozentuale Abrechnung: 45%
Hin- und Rücktransport per Kurierdienst zu Lasten des Kinos
Werbematerial 10,- Euro
Verleihkatalog
Милый, дорогой,
любимый, единственный
(DEAR, BELOVED, THE ONE AND ONLY) (Mein Lieber, Teurer, Einziger)
OmeU
SU 1984 (Lenfilm), 69min, Farbe, 35 mm, Format 1.1,37
Regie: Dinara Asanowa
Buch: Walerij Prijomychow
Kamera: Wladimir Iljin
Darst.: Olga Maschnaja, Walerij Prijomychow, Lembit Ulfsak, Lora
Umarowa, Nikolaj Lawrow, Aleksander Demjanenko
„In „Milyj, Dorogoj, Ljubimyj, Edinstwennyj“ untersucht Dinara
Assanowa, was die Generation der 18jährigen von der Liebe hält.
Die junge Heldin erschreckt durch ihre erschreckend infantile
Unbedarftheit in allen Lebenslagen. Der Sinn des Lebens, so wie
sie ihn aus alten Romanen herausliest, besteht für sie einzig
in der Liebe, und sie versucht, dies krampfhaft in die Tat umzusetzen.
Es ist jedoch nicht die Verliebtheit bin einen Gleichaltrigen,
sondern die pragmatische Beziehung zu einem Mitdreißiger, der
teure Geschenke und einen Hauch von schickem Leben in die Verbindung
bringt. Um ihren verheirateten Geliebten zu binden, stiehlt sie
ein Baby und gibt es als den gemeinsamen Sohn aus, ohne zu begreifen,
dass dieser Scherz ihr acht Jahre Haft einbringen kann.“
Oksana Bulgakowa in: Geschichte des sowjetischen und russischen
Films, hg von Christine Engel, Stuttgart 1999
Мой друг Иван
Лапшин
(Mein Freund, Iwan Lapschin)
OF russisch
SU1984 (Lenfilm),101min, 35mm, 1:1,37, Farbe
Regie: Aleksei German
Buch: Eduard Wolodarski(nach der Erzählung von Juri German)
Kamera: Waleri Fedosow
Darst.: Andrej Boltnew (Lapschin), Andrei Mironow (Chanin), Nina
Ruslanowa (Adschowa), Aleksei Sharkow (Okoschkin)
Auszeichnungen: Locarno 1986, Staatspreis der RSFSR 1987
Eine sowjetische Kleinstadt Mitte der dreißiger Jahre: Es ist
die Zeit des Kommunistischen Aufbaus und des Glauben an eine neue
Gesellschaftsordnung. Die Menschen leben in Kommunalwohnungen,
sind euphorisch getragen von einem Gemeinschaftsgefühl und im
provinziellen Theater erlebt ein Stück seine Premiere, in dem
die Umerziehung von Verbrechern und Volksfeinden zu aufrichtigen
Kommunisten und Arbeitern inszeniert wird. Man trifft sich im
Park und die erste Straßenbahn der Stadt dreht regelmäßig ihre
Runden. Eine der Kommunalwohnungen der Stadt wird von einer Männergemeinschaft
bewohnt, die Privatleben und Arbeit teilen. Iwan Lapschin arbeitet
wie seiner beiden Mitbewohner in der Kriminalabteilung und macht
Jagd auf eine skrupellose Gaunerbande. Dabei schreckt er auch
vor Gewalt nicht zurück und geht mit schonungslosen Verhörmethoden
gegen Verdächtige vor. Der „Mann aus Eisen“ erlebt jedoch immer
wieder Schwächemomente, sei es die unerwiderte Liebe zu einer
Schauspielerin oder regelmäßige Albträume bis hin zu epileptischen
Anfällen.
zit. aus: Eisensteins Erben, hg. von Eva Binder und Christine
Engel, Innsbruck 2002
Москва слезам
не верит
(Moskau glaubt den Tränen nicht)
OmdU
SU 1979 (Mosfilm), 140min (2 Teile), 1.Teil-1856m, 2.Teil- 2258m,
35 mm, Farbe,
Format 1:1,37
Regie: Wladimir Menschow
Kamera: Igor Slabnewitsch
Darst.: Wera Alentowa (Katerina), Irina Murawjowa (Ljudmilla),
Raisa Rjasanowa Antonina), Aleksej Batalow (Goscha)
Auszeichnungen: Bester Film - Sowjetskij Ekran 1980, Oscar 1980,
Brüssel 1981, Houston 1981
Der Film erzählt die Geschichte dreier Freundinnen Tonja, Ljudmilla
und Katja, die Mitte der fünfziger Jahre aus der Provinz nach
Moskau ziehen. Tonja heiratet ihren verlobten Nikolaj, Ljudmilla
ist auf der Suche nach einem passenden Mann und Katjas erste große
Liebe, der Kameramann Rudolf, verlässt sie, als sie schwanger
ist. 16 Jahre später hat Ljudmilla eine gescheiterte beziehung
zu dem Eishockeyspieler Serjoscha hinter sich und arbeitet in
einer chemischen Reinigung. Tonja ist Hausfrau und lebt mit ihrem
Ehemann und drei Söhnen in relativem Wohlstand. Katja hat beruflich
Karriere gemacht und ist zur erfolgreichen Fabrikdirektorin aufgestiegen.
Privat lebt sie ohne Partner mit ihrer Tochter, die sie allein
großziehen musste.. Eines Tages lernt Katja Goscha, einen charakterstarken
Arbeiter kennen und lieben, doch verheimlicht sie ihm ihre Position.
Als Goscha, der die führende Rolle des Mannes in der Familie beansprucht,
von Katjas Führungsposition erfährt, fühlt er sich ihr gegenüber
minderwertig und zieht sich zu Katjas großem Kummer für eine Zeit
zurück. Tonjas Ehemann Nikolaj macht sich auf die Suche nach Goscha
und bringt ihn zu Katja zurück.
zit. aus: Eisensteins Erben, hg. von Eva Binder und Christine
Engel, Innsbruck 2002
12 стульев
(12 Stühle)
OmdU
SU 1971 (Mosfilm), 153min (2 Teile), 1.Teil-2227m, 2.Teil-2192m,
35mm, Farbe, Format 1:1,37
Regie: Leonid Gaidai
Buch: W.Bachnow, Leonid Gaidai, nach dem gleichnamigen Roman von
Ilja Ilf und Jewgenij Petrow
Kamera: S. Polujanow
Darst.: Atschil Gomiaschwilli, S. Filippow, M. Pugowkin, K. Rumjanowa,
N. Kratschkowskaja
Auszeichnungen: Tiblissi 1972, Sorrento 1972


Der junge Gauner Ostap Bender sträunt durch die sowjetische
Provinz. In einem kleinen Städtchen lernt er den ehemaligen Adelsmarschall
Ippolit Matwejewitsch Worobjaninow kennen. Dieser ist in seine
Heimat zurückgekehrt, um nach den 12 Stühlen aus der Salongarnitur
seiner verstorbenen Schwiegermutter zu suchen. Möglicherweise
hatte Worobjanow die alte Dame sogar gemocht. Doch die Suche nach
dem Möbel hat nicht nur romantische Gründe. In einem der Polster
soll ein vor den Revolutionären versteckter Juwelenschatz eingenäht
sein. Worobjanow erzählt Bender von dem Geheimnis, der sich von
nun wie eine Klette an seine Fersen hängt. Doch bei der Jagd nach
dem Schatz bleiben die beiden nicht lange allein. Auch der Beichtvater
der Alten hat am Sterbebett von dem Geheimnis erfahren.
Жили-были
(Es war einmal)
ohne Dialog
BY 2001, 12 Min., 35mm, Farbe, Format 1:1,37, ohne Dialog,
Regie: Galina Adamowitsch
Musik: Wladimir Kurjan
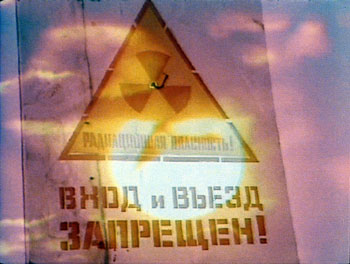

Belarus, dessen südliche Grenze nur wenige Kilometer von Tschernobyl
entfernt liegt, ist in erschreckendem Ausmaß von der Reaktorkatastrophe
1986 in Mitleidenschaft gezogen worden – zweidrittel des Landes
sind heute ökologisches Katastrophengebiet. Entsprechend waren
die Auswirkungen auf die Menschen. Viele sind seitdem gestorben,
auch der Fotograf Sergei Brushko, der das Leben vor der Katastrophe
in beeindruckenden Bildern festgehalten hat, starb im Alter von
nur 42 Jahren. Seine Bilder lassen das einstige Leben wieder entstehen
und die Musik schlägt die Brücke vom Heute zum Gestern. Nach dem
Genozid an der damals mehrheitlich jüdischen Bevölkerung durch
die Nazis war der GAU die zweite große Katastrophe im 20. Jahrhundert.
Колокол Чернобыля
(Das Signal von Tschernobyl)
Original russisch / deutsch overvoice
SU 1986, 88 min., 35 mm, Format 1:1,37, Farbe
Regie: Rolan Sergejenko


Rolan Sergejenko gehörte zu den ersten professionellen Filmemachern,
die nach der Katastrophe in Tschernobyl zu drehen begannen. Die
Bilder für das SIGNAL VON TSCHERNOBYL wurden nur wenige Tage nach
dem Vorfall im Kraftwerk gemacht. Viele durch radioaktive Strahlung
veränderte Bilder zeigen, wie nahe die Kamera dem atomaren Inferno
war. Der Film zeigt Mitarbeiter des Kraftwerks, Liquidatoren und
ihre Angehörigen, Anwohner der Kraftwerksstadt, betroffene Dorfbewohner,
medizinisches Personal, Militärangehörige und Aufbauhelfer.
"Der Aufbau unseres Filmarchives wird gefördert
mit Mitteln des Programms: LSK"

|
|